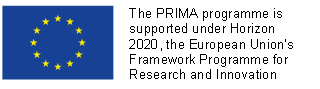Soziale Landwirtschaft stellt einen zusätzlichen Betriebszweig im Rahmen der Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe dar und trägt gleichzeitig zur Stärkung des sozialen Sektors im ländlichen Raum bei. Beispiele hierfür sind unter anderem Bauernhofkindergärten, Betreuung von Senioren sowie Inklusionsarbeitsplätze. Die Ziele des Projekts lassen sich in zwei Bereiche untergliedern. Zum einen soll der Betriebszweig Sozialen Landwirtschaft in Bayern gestärkt werden. Zum anderen werden innovative Ansätze zur Verbesserung der sozialen Strukturen im ländlichen Raum ausgearbeitet.
Zur Umsetzung dieses Vorhabens stehen die folgenden spezifischen Projektziele im Mittelpunkt:
Untersuchung des Wissensstandes und des Interesses bayerischer Landwirte an Sozialer Landwirtschaft sowie an entsprechenden Konzepten für verschiedene Zielgruppen
Nachfrageanalyse für die Soziale Landwirtschaft aus Sicht potenzieller Nutzergruppen
Systematischer Aufbau und Evaluation ressortübergreifender, regionaler Netzwerke zur Unterstützung bei der Umsetzung von Angeboten in der Sozialen Landwirtschaft (Reallabore)
Weiterentwicklung praxisorientierter Informationsmaterialien und Konzepte (z. B. Tools zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit, Unterlagen zur Zusammenarbeit mit potenziellen Kooperationspartnern)
Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Politik, Verbände und weitere relevante Akteure zur Förderung der Bekanntheit und Verbreitung Sozialer Landwirtschaft
Projektleitung: Prof. Klaus Menrad
Projektkoordination: Dr. Thomas Decker
Projektbearbeitung: Guido Cremerius M.A.; Dr. Thomas Decker
Projektdauer
2025-04-01 – 2028-03-31
Beteiligtes Personal
Projektleitung
Projektkoordination
Projektausführung

Guido Cremerius, M.A.
Professur Marketing und Management Nachwachsender Rohstoffe
- Doktorand
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Telefon:
- +49 9421 187-207
- Email:
- guido.cremerius@hswt.de
Projektpartner
Funding
Förderprogramm: Förderung der Agrarforschung durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
Förderer: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
Träger: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
- Förderungs-ID
- A/24/17

Die Transformation einer fossilbasierten zu einer biobasierten Wirtschaft lässt eine erhöhte Holznutzung erwarten. Holz ist der bedeutendste nachwachsende Rohstoff. Zur effizienten Nutzung und langfristigen Kohlenstoffbindung ist jedoch eine zirkuläre Holznutzung unerlässlich. Im Jahr 2018 wurden von den in Bayern angefallenen 1,59 Mio. Tonnen Altholz nur 20 Prozent stofflich, dagegen 80 Prozent energetisch genutzt, obwohl die überwiegende Menge den Kategorien A I (nicht verunreinigt) und II (nur geringfügig verunreinigt) zuzuordnen ist. In der Bundesrepublik Deutschland herrscht eine ähnliche Diskrepanz zwischen stofflicher und energetischer Altholznutzung. Insofern besteht dringender Handlungsbedarf hin zu einem kreislauforientierten Paradigmenwechsel in der Altholzverwendung, um das Substitutions- und Kohlenstoffspeicherungspotenzial deutlicher auszuschöpfen. Zur Schaffung kaskadierender Wertschöpfungsketten sind gemeinsam mit Schlüsselakteur:innen Innovationen zu entwickeln, die vom kreislaufgerechten Design über Logistik und Aufbereitungskonzepte bis hin zu stofflichen Altholznutzungspfaden reichen.
Ziel des Vorhabens ist somit die Erstellung eines Innovationskonzepts zur stofflichen Nutzung von Altholz in einem Open Innovation-Ansatz und dessen Validierung in Reallaboren in Bayern. Die Ergebnisse münden in eine Transformations-Roadmap, welche Optimierungspotenziale und konkrete Maßnahmen für eine Implementierung des Konzepts in der Praxis sowie Transfermöglichkeiten in andere Regionen aufzeigt.
Neben der Modellierung des zukünftigen Altholzaufkommens und der Optimierung der Altholzwertschöpfungskette werden mehrere Aufgabengebiete verfolgt:
(1) Dimensionserhaltende Nutzung von Altholz
(2) Altholz in der Bioraffinerie
(3) Altholz als Substrat für Pilzmyzel basierte Werkstoffe
(4) Entwicklung von kreislaufbasierten Geschäftsmodellen
(5) Ökologische Bewertung der Innovationspfade
(6) Verbraucherakzeptanz der Innovationspfade
Projektleitung: Prof. Dr. Klaus Menrad
Projektkoordiation: Dr. Thomas Decker
Projektbearbeitung: Jonas Krauß, M.A.; Dr. Thomas Decker
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert und läuft vom 01.01.2023 bis 31.12.2027.
Zu den Projektpartnern gehören neben der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf die Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern gGmbH (Projektkoordination), die Technische Universität München, die Technische Hochschule Rosenheim, die Bayrische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, die Franz Obermeier GmbH und die Landpack GmbH. Des Weiteren sind die Pfleiderer Deutschland GmbH und Durmin Entsorgung und Logistik GmbH, der Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau sowie die UPM Biochemicals GmbH als assoziierte Partner unterstützend tätig. Daneben agieren das Chemiecluster Bayern GmbH, das Cluster neue Werkstoffe und Umweltcluster Bayern als Wissenstransferpartner in dem Projekt.
Projektdauer
2023-01-01 – 2027-12-31
Beteiligtes Personal
Projektkoordination
Projektausführung

Jonas Krauß, M.A.
Professur Marketing und Management Nachwachsender Rohstoffe
- Doktorand
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Telefon:
- +49 9421 187-210
- Email:
- jonas.krauss@hswt.de
Projektpartner
Funding
Das Projekt wird im Rahmen der Maßnahme „REGULUS - Regionale Innovationsgruppen für eine klimaschützende Wald- und Holzwirtschaft“ vom BMBF unter dem Förderkennzeichen 033L303A gefördert.
- Förderungs-ID
- 033L303A
Arbeitspaket (AP) 2 – Konsumentenakzeptanz
Ziel des ProxIMed Projekts ist es, Proteine aus nachhaltigen Quellen in die Lebensmittel- und Futtermittelsysteme des Mittelmeerraums einzuführen. Dadurch soll die Verwendung alternativer Proteine gefördert und etabliert werden. Hierzu werden traditionelle alternative Proteinquellen pflanzlichen Ursprungs (Linsen, Ackerbohnen und Chiasamen), "Novel Food"-Proteinquellen (Mikroalgen, Insekten, Mykoprotein, Tomaten- und Malvenblätter, Wasserlinsen) und Nebenprodukte aus der Landwirtschaft (Tomatentrester, Sesam-, Dattelkuchen) ausgewählt. Zur Herstellung der Proteine werden innovative und umweltfreundliche Verarbeitungstechnologien eingesetzt, die auf eine minimale Belastung der Nährstoffe abzielen. Die alternativen Proteine werden dann in mehr als 20 Endprodukten (Proteinpulverkonzentrate als Zutaten, Kapseln zur Verwendung als Nahrungs-ergänzungsmittel und verschiedene proteinangereicherte Lebens- und Futtermittel) eingesetzt und den Verbrauchern im Mittelmeerraum in verschiedenen Regionen (Naher Osten, Nordafrika und Europa) vorgestellt.
Im AP2 werden verschiedene Untersuchungen zu Verbraucheraspekten und der Erprobung neuer Marketing- und Geschäftsstrategien für neuartige alternative Protein-Lebensmittelprodukte durchgeführt. Dabei wird das allgemeine Interessen der Verbraucher in drei Mittelmeerländern (Türkei, Tunesien, Portugal) an den verschiedenen Lebensmittelprodukten (fermentierte Gemüse-Pickles und Tahin - traditionelle Produkte für die Länder des Nahen Ostens und des Mittelmeerraums; Snackprodukte, Sporternährungsprodukte und Proteinpulver) und Rohstoffquellen für alternative Proteine (z.B. Insekten, Mykoprotein) analysiert.
Dieses Projekt ist Teil des von der Europäischen Union unterstützten PRIMA-Programms und läuft vom 01.04.2023 bis zum 31.07.2027.
Projektteam AP2: Prof. Dr. Klaus Menrad (Leitung), Dr. Agnes Emberger-Klein, Tura Kaso Hamo
Verbundprojektleitung: Prof. Dr. Özlem Özmutlu Karslioglu (HSWT)
Weitere Abbildungen
Projektdauer
2023-04-01 – 2027-07-31
Beteiligtes Personal
Projektkoordination
Projektausführung

Tura Kaso Hamo, M.Sc.
Professur Marketing und Management Nachwachsender Rohstoffe
- Doktorand
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Telefon:
- +49 9421 187-214
- Email:
- tura.hamo@hswt.de

Klimafreundliche Antriebe in der Landwirtschaft können dazu beitragen, Treibhausgase in der Pflanzenproduktion zu reduzieren und somit die Klimaschutzziele des Agrarsektors zu erreichen. Übergeordnetes Ziel des Projekts „TrAkzeptanz“ ist es, die Akzeptanz von klimafreundlichen Antrieben in der Landwirtschaft am Beispiel „Traktor“ zu stärken und ihren vermehrten Einsatz zu fördern. Mit Hilfe von verschiedenen Arbeitsschritten (Ist-Analyse, Analyse von Chancen und Risiken, Untersuchung von Akzeptanz und Kaufmotiven, theoretischen Szenarien und praxisorientierten Fallstudien) werden Anreizmechanismen entwickelt, um den Übergang zu klimafreundlichen Antrieben in der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion voranzutreiben. Diese Anreizmechanismen und die dazugehörigen Projektergebnisse werden durch geeignete Formate an Landwirte, landwirtschaftliche Maschinenhändler, Industrie-, Politik- und Pressevertreter sowie die breite Öffentlichkeit kommuniziert.
Hierzu werden zunächst der Entwicklungsstand alternativer Antriebe für Landmaschinen sowie die regulatorischen Rahmenbedingungen mithilfe einer Literaturrecherche und Expertengesprächen aufgezeigt. Darauf aufbauend werden anhand von Befragungen der Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette („Stakeholder“) Hemmnisse und Beweggründe für die Umstellung auf klimafreundliche Antriebstechnologien identifiziert. Anschließend werden Szenarien erstellt, die die mögliche Entwicklung der Marktdurchdringung erneuerbarer Antriebssysteme in der Landwirtschaft bis hin zum vollständigen Ersatz von fossilem Dieselkraftstoff abbilden. Für diese Szenarien werden die Effekte auf nationaler Ebene, insbesondere hinsichtlich der THG-Einsparung, der THG-Minderungskosten sowie dem erforderlichen Energie- und Rohstoffbedarf ermittelt. Bei einem vollständigen Ersatz von Dieselkraftstoff durch nachhaltige klimafreundliche Antriebsenergien könnten so rund 5 Mio. t Treibhausgase („Tank-to-wheel“) in Deutschland eingespart werden. Daneben werden auf betrieblicher Ebene die Effekte bei der Umstellung auf klimafreundliche Antriebe mittels Fallstudien untersucht. Hierbei werden reale landwirtschaftliche Betriebe modellhaft auf einen Mix geeigneter Antriebstechnologien umgestellt. Die daraus folgenden betriebswirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen werden im Vergleich zum Status quo bewertet. Schließlich werden auf Basis der vorangegangenen Untersuchungsschritte und unter Berücksichtigung nationaler und betriebsspezifischer Effekte Anreizmechanismen erarbeitet, die den Umstieg auf klimafreundliche Antriebe in der Landwirtschaft forcieren helfen. Die Ergebnisse aus dem Vorhaben werden durch die Mitwirkung verschiedener Akteure bei Workshops und Diskussionsrunden bereichert sowie validiert und anschließend in geeigneten Formaten Landwirten, dem Landmaschinenhandel, der Industrie und Politik sowie der breiten Öffentlichkeit vermittelt.
Im Einzelnen sollen mit Hilfe der Projektergebnisse folgende Fragen beantwortet werden:
(1) Was ist der aktuelle Stand der Technik von alternativen Antrieben für Traktoren und wohin geht die Entwicklung?
(2) In welchem regulatorischen Rahmen erfolgen die Entwicklung, das Inverkehrbringen und der Einsatz von Traktoren mit klimafreundlichen Antrieben sowie die Bereitstellung erneuerbarer Antriebsenergien?
(3) Welche Chancen und Risiken für eine erfolgreiche Marktdurchdringung für alternative Antriebe von Traktoren sehen unterschiedliche Akteure?
(4) Wie hoch ist die Akzeptanz von Traktoren mit alternativen Antrieben bei Landwirten?
(5) Welche Anreizmechanismen müssen geschaffen werden, um die Marktdurchdringung von Traktoren mit alternativen Antrieben zu erhöhen?
(6) Welchen Beitrag können landwirtschaftliche Betriebe durch den Einsatz von Traktoren mit klimafreundlichen Antrieben zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten?
Die Fragestellungen werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Professur für Marketing und Management Nachwachsender Rohstoffe, des Technologie- und Förderzentrums sowie des Bundesverbands Bioenergie bearbeitet. Das Projektkonsortium setzt sich somit aus Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen mit hoher Expertise in der vorgeschlagenen Themenstellung zusammen und gewährleistet so die erfolgreiche Durchführung des Vorhabens. Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen des BMEL Forschungs- und Innovationsprogramms „Klimaschutz in der Landwirtschaft“. Die Laufzeit ist vom 01.04.2024 bis zum 31.03.2027.
Projektleitung: Prof. Klaus Menrad
Projektkoordination: Dr. Thomas Decker
Projektbearbeitung: Johannes Buchner, M.Sc.; Dr. Thomas Decker
Projektdauer
2024-04-01 – 2027-03-31
Beteiligtes Personal
Projektkoordination
Projektausführung

Johannes Buchner, M.Sc.
Professur Marketing und Management Nachwachsender Rohstoffe
- Doktorand
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Telefon:
- +49 9421 187-203
- Email:
- johannes.buchner@hswt.de
Vor dem Hintergrund hoher Umweltbelastungen und eines starken Energieinputs im Baugewerbe sollen innovative Produkte für den Innenausbau entwickelt und deren Akzeptanz untersucht werden. Durch Zugabe von Pflanzenfasern und Schäumen soll das Gewicht von Lehmbauplatten reduziert werden und leichtere, naturfaserverstärkte Lehmbauplatten entwickelt werden. Die Anforderungen von Handwerker:innen und Verbraucher:innenn an solche Platten werden ebenfalls analysiert. Spezifische Projektziele sind:
- Untersuchung der Machbarkeit von naturfaserverstärkten Lehm-Schäumen aus Nachwachsenden Rohstoffen zur Gewichtsreduktion in Lehmbauplatten
- Entwicklung von leichteren, naturfaserverstärkten Lehmbauplatten auf dieser Basis
- Analyse des Interesses von Bauwilligen und Handwerkern an solchen Lehmbauplatten
- Erstellen von Informationsmaterialien für Baustoffhandel und Handwerk zu Lehmbauplatten und leichteren Lehmbauplatten auf Basis von pflanzenfaserverstärkten Schäumen
Projektdauer
2024-01-01 – 2026-12-31
Beteiligtes Personal
Projektausführung

Sebastian Gründig, M.A.
Professur Marketing und Management Nachwachsender Rohstoffe
- Doktorand
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Telefon:
- +49 9421 187-223
- Email:
- sebastian.gruendig@hswt.de
Funding
Gefördert wird es vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
Des Weiteren werden Unternehmen aus der Agrarbranche und Baubranche an dem Projekt beteiligt sein.
Das Projekt „NWG-Torfersatz“ untersucht die Nutzung regionaler Reststoffe und nachwachsender Rohstoffe als Torfersatzstoffe in Blumenerden und Kultursubstraten. Ziel ist es, den Einsatz von Torf im Gartenbau zu reduzieren und durch umweltfreundlichere Alternativen zu ersetzen. In einem interdisziplinären Ansatz werden die ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte dieser neuen Substratmaterialien umfassend bewertet.
Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit zwischen mehreren Forschungseinrichtungen durchgeführt. Die Koordination liegt bei der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) in Freising, welche durch das Institut für Gartenbau (IGB) vertreten ist. Als Kooperationspartner sind die Technische Hochschule Rosenheim (THRO) und der TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit (MNR-TUMCS) beteiligt. Das Projekt umfasst mehrere spezifische Teilaufgaben, die von den beteiligten Institutionen koordiniert werden:
- Teilaufgabe A (HSWT): Evaluation neuer Torfersatzstoffe sowie Entwicklung von Verfahren zur Qualitätsbeurteilung und Torfquantifizierung.
- Teilaufgabe B (THRO): Aufbereitung regionaler Reststoffe und nachwachsender Rohstoffe für die Verwendung als Torfersatzstoff.
- Teilaufgabe C (MNR-TUMCS): Nachhaltigkeitsbewertung der Torfersatzstoffe, einschließlich ökologischer Bilanzierung, ökonomischer Bewertung und sozialer Nachhaltigkeit.
Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf übernimmt die Gesamtprojektleitung sowie die qualitativen Untersuchungen der Torfersatzstoffe und führt weiterführend die pflanzenbaulichen Versuche durch. Diese Versuche konzentrieren sich auf die Prüfung der Eignung der neuen Substrate für den Einsatz im Gartenbau, wobei sowohl Labor- als auch praxisnahe Experimente durchgeführt werden. Die Technische Hochschule Rosenheim ist für die Aufbereitung der regionalen Reststoffe und nachwachsenden Rohstoffe verantwortlich. Hierzu gehören die Beschaffung, Aufbereitung und Optimierung der Rohstoffe, um deren Eignung als Substratausgangsstoffe sicherzustellen. Der TUM Campus Straubing widmet sich der umfassenden Nachhaltigkeitsbewertung der neuen Torfersatzstoffe.
Im Rahmen der Nachhaltigkeitsbewertung (Teilaufgabe C) werden die Umweltwirkungen der neuen Torfersatzstoffe entlang der gesamten Wertschöpfungskette systematisch untersucht. Schwerpunkte dieser Untersuchung sind die Erfassung und Auswertung grundlegenden Daten der Produktion wie der Verarbeitung. Mithilfe von Ökobilanzierungen sollen sowohl die ökologischen Vorteile als auch potenzielle ökologische Belastungen der neuen Substrate identifiziert werden, um eine fundierte Bewertung ihrer Nachhaltigkeit zu ermöglichen.
Die ökonomische Analyse soll sich auf die Bewertung der Kosten und Verfügbarkeit der neuen Torfersatzstoffe konzentrieren. Dabei sollen regionale Mengen sowie die mögliche Preisgestaltung für Substrathersteller analysiert werden, um die Marktpotenziale und die wirtschaftliche Tragfähigkeit der neuen Substrate zu ermitteln. Ein weiterer Bestandteil der Bewertung soll die soziale Nachhaltigkeit sein. In diesem Bereich soll ein Ansatz zur Bewertung der sozialen Auswirkungen der neuen Substrate entwickelt werden, insbesondere im Hinblick auf Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen in den betroffenen Branchen.
Zusätzlich sollen innerhalb des Projektes Maßnahmen zur Einführung der neuen Torfersatzstoffe in die gärtnerische Praxis entwickelt werden. Diese umfassen die Anpassung von Kulturverfahren sowie die Bereitstellung von Handlungsempfehlungen für Produzenten und Anwender, um die Umstellung auf torffreie Substrate zu unterstützen.
Langfristig zielt das Projekt darauf ab, den Einsatz von Torfersatzstoffen in Blumenerden und Kultursubstraten signifikant zu steigern, um den ökologischen Fußabdruck der gärtnerischen Produkte zu reduzieren. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die systematische Bewertung sollen zudem die wissenschaftliche Expertise in diesem Bereich ausgebaut und Grundlagen für zukünftige nachhaltige Entwicklungen geschaffen werden.
Laufzeit: 01.07.2023-30.06.2026
Verbundprojektleitung: Dr. Dieter Lohr
Teilprojektleitung: Prof. Dr. Klaus Menrad
Projektkoordination: Dr. Dieter Lohr
Projektbearbeitung: Michael Mußer, M.Sc., IGB (Teilaufgabe A), Alisa Kehr, M.Sc., THRO (Teilaufgabe B), Phillip Olak, M.Sc., MNR (Teilaufgabe C)
Weitere Abbildungen
Projektdauer
2023-07-01 – 2026-06-30
Beteiligtes Personal
Projektkoordination
Projektausführung

Phillip Olak, M.Sc.
Professur Marketing und Management Nachwachsender Rohstoffe
- Doktorand
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Email:
- phillip.olak@hswt.de
TUM Campus Straubing
Am Essigberg 3
94315 Straubing
Zur Erreichung der Klimaziele muss auch der Gebäudebestand klimaneutral werden. Hierzu sind ambitionierte Energiestandards für Neubauten nötig und eine deutliche Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit im Bestand. Auch den eingesetzten Materialien kommt eine entscheidende Bedeutung zu. Ein wichtiges Baumaterial sind dabei die biobasierten Dämmstoffe. Durch deren verstärkten Einsatz kann der Energiestandard der Gebäude verbessert werden und ein Beitrag zur Umsetzung der Ziele des Klimaschutzprogramms Bayern 2050 erreicht werden. Zugleich kann auch eine Reduktion des Verbrauchs fossiler Rohstoffe, ein Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz sowie zur Wohngesundheit erzielt werden.
Für die Dämmung von Gebäuden werden in Deutschland jedoch bislang v. a. konventionelle Dämmstoffe genutzt, biobasierte Dämmstoffe spielen immer noch eine untergeordnete Rolle. Zudem konnten die Marktanteile biobasierter Dämmstoffe deutschlandweit bislang kaum gesteigert werden, obwohl sie hinsichtlich technischer Eigenschaften konventionellen Dämmstoffen ebenbürtig sind, ökologische Vorteile aufweisen und zur Wohngesundheit beitragen. Trotz der z.T. höheren Kosten zeigen jedoch einige Verbraucherstudien in Deutschland positive Einstellungen zu diesen Dämmstoffen unter Privatpersonen und die grundsätzliche Bereitschaft zu deren Verwendung. Untersuchungen legen dagegen nahe, dass die geringe Marktdurchdringung u.a. auch mit dem fehlenden Willen verschiedener anderer Akteure im Baugewerbe zusammenhängt, biobasierte Dämmstoffe zu verbauen bzw. mit deren zu geringem Kenntnisstand hierzu.
Eine Möglichkeit biobasierte Dämmstoffe weiter in den Markt zu bringen, stellt deren finanzielle Förderung dar. Da der Einsatz biobasierter Dämmstoffe auf Bundes- und Landesebene (BY) derzeit nicht gefördert wird, können hier Kommunen besondere Anreize setzen. Diese Möglichkeit nutzen auch verschiedene Kommunen in Deutschland, um damit z. B. eigene Klimaziele besser erreichen zu können.
Ziel des Projekts BioDämm ist es vor diesem Hintergrund, den Status Quo der Verwendung von biobasierten Dämmstoffen in privaten Wohngebäuden in Bayern zu untersuchen. Das Projekt adressiert hierbei verschiedene wirtschaftliche und gesellschaftliche Akteure, nämlich private Hauseigentümer und Bauherren, Akteure des Baugewerbes sowie die Rolle von Kommunen. Im Einzelnen sollen mit Hilfe der Projektergebnisse folgende Fragen beantwortet werden:
(1) In welchem Umfang werden bislang in Bayern biobasierte Dämmstoffe in Wohngebäuden und speziell in Kommunen mit kommunaler Förderung von biobasierten Dämmstoffen eingesetzt?
(2) Wie sind das derzeitige Interesse und die Akzeptanz von biobasierten Dämmstoffen unter privaten Hauseigentümern, Bauherren und relevanten Akteuren des Baugewerbes in Regionen mit und ohne kommunale Förderung in Bayern?
(3) Welche Faktoren hemmen und fördern einen gesteigerten Einsatz von biobasierten Dämmstoffen in Wohngebäuden in Bayern?
(4) Können kommunale Förderprogramme den Einsatz von biobasierten Dämmstoffen in privaten Wohngebäuden steigern und wie müssen die Programme gestaltet sein, damit sie zu einem vermehrten Einsatz dieser Materialien führen?
Das Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gefördert. Die Laufzeit ist vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2025.
Projektleitung: Prof. Dr. Klaus Menrad
Projektkoordination: Dr. Agnes Emberger-Klein
Projektbearbeitung: Dipl. Ing. Isabell Limbrunner, Dr. Agnes Emberger-Klein
Projektdauer
2023-01-01 – 2025-12-31
Beteiligtes Personal
Projektkoordination
Projektausführung

Dipl.-Ing. Isabella Limbrunner
Professur Marketing und Management Nachwachsender Rohstoffe
- Doktorandin
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Telefon:
- +49 9421 187-213
- Email:
- isabella.limbrunner@hswt.de